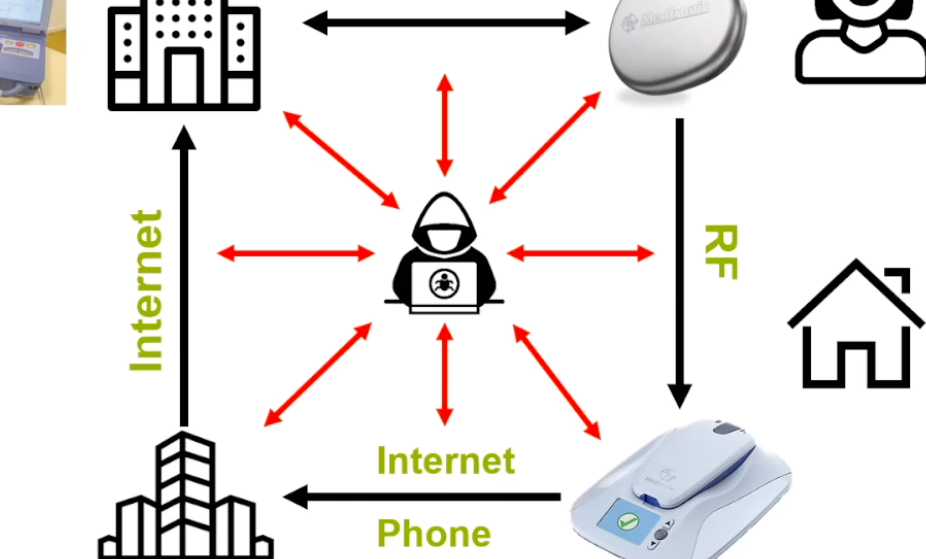Meinetwegen hätte Cory Doctorow in seiner Buchempfehlung für „After World“ von Debbie Urbanski ruhig erwähnen dürfen, wie depressiv das Buch ist. Obwohl, „relentlessly bleak“ ist bei Tageslicht betrachtet dann doch deutlich genug. Vielleicht hatte ich das überlesen. Hat dann jedenfalls nicht lange gedauert, bis ich selber drauf gekommen bin. Depressiv.
Ich weiß gar nicht so recht, wovon das Buch handelt, wenn nicht vom Gefühl der inneren Katastrophe, die mit gnadenloser Härte in Form wie Inhalt des Textes angereicht wird. Repitition, Isolierung, Unverständnis, unendlicher Schmerz, der Untergang des Ich. Der Untergang der Welt ist dabei die einzig mögliche Kulisse, aber letztlich eben nicht nur das.
Die Grausamkeit des Menschen gegen alles und sich selbst wird als Kammerstück aufgeführt. Die Erzählperspektive des [storyworker] ad39-393a-7fbc demonstriert dabei beinahe mehr Humanismus als die Menschen selber. Diese Software muss sich vom übergeordneten Prozess emly denn auch fragen lassen: „Why would you want to think like a human being?“. Diese Frage ist wiederum selber eine Antwort. „…is it possible to tell a human story without human suffering, is it possible to tell a human story without the suffering of the world“
Gewiss, „After World“ ist auch Cli-fi. Der Weltuntergang per Klimakatastrophe ist eine ausgemachte Sache, die Apokalypse aber kommt in Form eines Virus über die Menschheit. Ist die Vernichtung Erlösung? Für wen? In gewisser Weise stemmt sich das ganze Buch gegen diese doppelte Zerstörung, einmal der natürlichen Umwelt und einmal der Menschheit selber. Dass kein plausibler Ausweg angeboten wird, ist einzusehen und wohl dem Genre eigen.
Die Beschreibung der inneren Katastrophe ist anscheinend der bislang beste Weg, den kommenden Untergang als die unausweichliche Auslöschung jeder Menschlichkeit zu erzählen und nicht als unterhaltsames Spektakel. Denn dafür haben wir ja schließlich die Tagesschau.
Bild oben: Ein Mural, gesehen im Sommer in einer Unterführung in Jelenia Góra