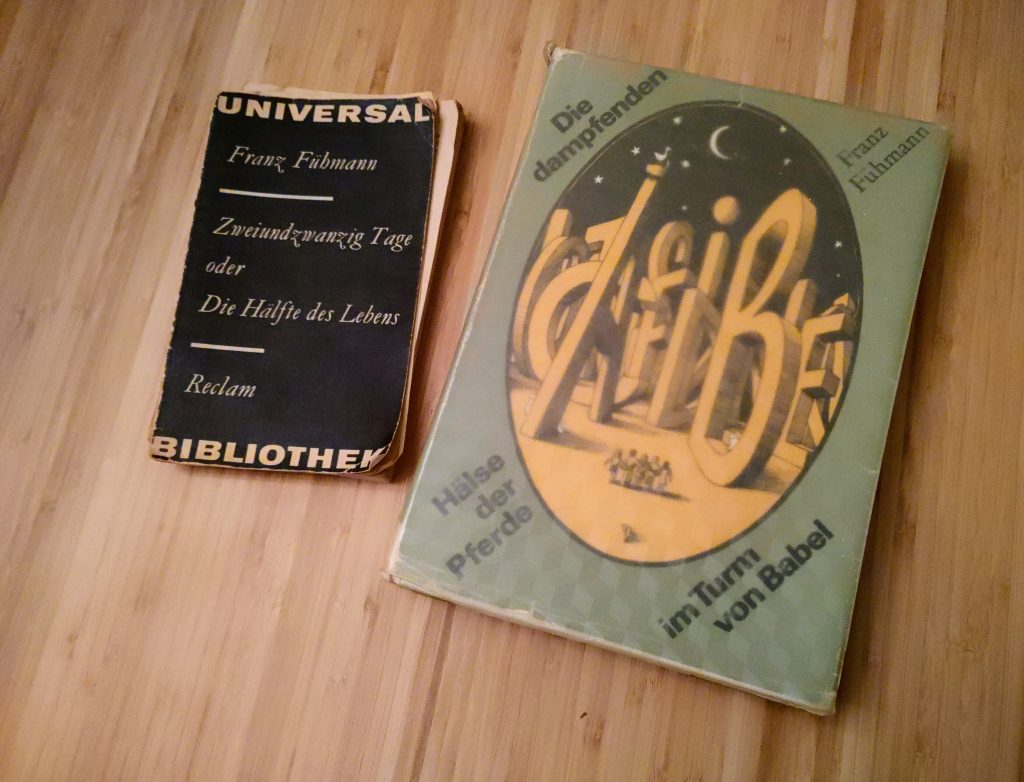Drei Texte, gelesen in den letzten Tagen, einmal Erläuterungen zum sich wandelnden Kunsthandel, ein schöner Rant über die Individualisierung der Pandemiehölle und ein guter Überblick zur Deindustrialisierung in den osteuropäischen Transformationsgesellschaften.
***
Ingo Arend in der Süddeutschen Zeitung mit einem instruktiven Überblick über den Kunstmarkt (nicht im übertragenen, sondern genau im ökonomischen Sinne) und dessen pandemiebedingt beschleunigten Wandel hin zu einer digitalen, plattformbasierten, reichlich intransparenten Angelegenheit. Bei der setzen sich wenige big players gegen die kleinen Galerien, aber auch gegen traditionsreiche, aber unbeweglichere und letztlich auch kapitalschwächere Messen durch. Klingt irgendwie bekannt, oder? Eine vergleichende Untersuchung zu den Transformationsprozessen anderer Branchen mit denen „in der elegantesten Spielhölle des Kapitalismus“ würde ich, zB von Arend, auch als Buch lesen.
***
Apropos Buch, „Die schlechteste Hausfrau der Welt“ habe ich immer noch nicht gelesen, was unter anderem daran liegt, dass ich das Werk noch nicht mal gekauft hab. Das wird aber noch, versprochen. Jedenfalls hat Jacinta Nandi in der ak den Blick auf Versagen und Vorwurf als mögliche Ausdrucksformen des deutschen Nationalcharakters geworfen, in der Pandemie zumal. Ich fühle mich abgeholt von dem Text, vielleicht auch ein bisschen erwischt, auf jeden Fall aber gut unterhalten. Und das ist mir wichtig, auch in den Flugschriften des Klassenkampfes. Denn wenn ich nicht lachen kann, ist es nicht meine Revolution. Basta.
***
„Von Anerkennung und Respekt kann man bekanntlich keinen Lebensunterhalt bestreiten.“ – Schön gesagt, und zwar in einem Stück zum Ende der Werften in Mecklenburg-Vorpommern von Philipp Ther bei Zeit Online. Der Historiker schlägt einen weiten Bogen, der die kulturelle, wirtschaftliche und politische Bedeutung des Schiffbaus im Ostblock ganz interessant zusammenfasst. Auf so engem Raum einen solchen Überblick anzubieten, das muss man erstmal hinbekommen.
Für mich waren die entsprechenden aktuellen Nachrichten ein wenig déjà-vu. Anfang der Neunziger war die Deindustrialisierung des Ostens schließlich das lebensbestimmende Thema, wenn man da aufwuchs, nicht wahr. Die Symbolkraft der Werften (und des industriell betriebenen Fischfangs) lässt sich gar nicht überschätzen für den Nordosten. Gingen mit der wirtschaftlichen Einebnung der Kerne, ihrer Zulieferer und Weiterverarbeiter ja nicht nur ganz materiell Arbeitsplätze, also Einkommensoptionen für unglaublich viele Menschen verloren, sondern auch deren Lebensperspektive neben der Maloche. Auf Sozialhilfe angewiesen zu sein, macht eben ganz schnell nicht nur ökonomisch arm.
Es ist drei Jahrzehnte später vielleicht schwer vorstellbar, wie unfassbar trostlos das alles war damals. Selbst der Protest von Belegschaften, mit ihren Betriebsbesetzungen und allem, war am Ende dann doch immer nur vorhersehbar aussichtslose Folklore. Das kommt in so nem Text wie dem von Ther ein bisschen knapp und unterkühlt rüber (was ich jetzt überhaupt nicht als Vorwurf meine, nebenbei).