No, I don’t mean love, when I say patriotism. I mean fear. The fear of the other. And its expressions are political, not poetical: hate, rivalry, aggression. It grows in us, that fear. It grows in us year by year.
Left Hand of Darkness – Ursula K. Le Guin
Posts Tagged → Sensibilität
Ohne Ort
Nachdem ich im vergangenen Jahr voll crazy gleich drei Berlinale-Filme gesehen hatte, bin ich dieses Mal zur Tradition des Besuchs genau eines Festival-Beitrags zurückgekehrt. Ausgerechnet in diesem furchtbaren Cubix-Block am Alex, wo Freitagmittag die Hardcore-Besucher*innen wie auch Mitarbeiter*innen nur noch Zombie-Charme ausstrahlen. Es wirkt wie der Schichtwechsel einer dystopischen Fabrik, die in halbwegs sterilen Werkstatträumen etwas unbestimmt waffenähnliches produziert. Mit grauen Gesichtern schleppen sie sich durch die charakterlose Architektur in langen Reihen aneinder vorbei. Die einen nach oben („Noch ein Film!“), die andern nach unten. Zwischendrin Unisex-Toiletten. Wokes Pissen in Berlin-Mitte. Wenn das [beliebige Zusammenrottung des abendländischen Kulturkampfes] wüsste…
Zu sehen gab es „Reifezeit“ in digital restaurierter Fassung. Ein Film, zufällig genauso alt wie ich. Gedreht zumindest in Teilen im Kiez süd-östlich des Bahnhofs Gesundbrunnen. Bis auf ein Straßenschild an der Kreuzung Swinemünder-Ramlerstraße stellt Regisseur Sohrab Shahid Saless Berlin aber überhaupt nicht aus. Die Mauer ist nur ein paar hundert Meter weit weg. Einmal um die nächste Straßenecke geschaut wäre der Fernsehturm auf der anderen Seite ins Bild gedrängt.
Nein, der Film hat keinen zwingenden Ort, vielleicht nicht einmal eine stark eingegrenzte Zeit. Die findet ohnehin nur als Maß der eintönigen Wiederholung im unlebbaren Leben der Protagonist*innen statt. Mit den Augen eines 9-jährigen Kindes werden die schablonenhaften Erwachsenen in ihrer ganzen Verlorenheit gezeigt. Deren Unfähigkeit, eine Welt zu gestalten, die ihren Nachkommen anderes Leben ermöglicht, wird dabei nicht als Vorwurf formuliert. Sie wird einfach nur als Fakt gezeigt.
Es ist alles ein bisschen wie naturalistisches Theater, aber als Film. Das erste Wort wird nach 20 Minuten gesprochen. Saless verwendet mit statischer Kamera die Treppenhäuser im Wedding, die trostlosen Zimmer, die kühlen Gänge der Schule wirklich wie Theaterkulissen. Licht und Schatten, Treppen hinauf, Treppen hinab. Wenn die Darsteller*innen sich nicht bewegen, bewegt sich auch sonst nichts. Selbst eine S-Bahnfahrt bringt da keine optische Erlösung. Die Fahrt auf einem Fahrrad, immer in einem Kreis, der nicht weiter als eine Toreinfahrt reicht, unterstreicht nur die Enge und Unbeweglichkeit.
Das meiste wird dabei in Andeutungen erzählt. Kleine Handlungen nur, die dieser Welt ihren Rahmen geben. Der Diebstahl einer Schokolade. Das wiederholte Abschminken der Mutter, nach getaner (Sex-)Arbeit. Da muss gar nicht grafisch gezeigt werden, wie schlimm das Geschehen selbst ist. Es wird sichtbar, wie schlimm es wirkt. Das ist alles nicht pädagogisch verpackt, sondern trotz der offensichtlichen Gesellschaftskritik seltsam unvoreingenommen, kindlich fast und insofern ein extrem gelungenes Beispiel für den Einsatz eines so jungen Hauptdarstellers.
Bild oben: Die Kreuzung Swinemünder Straße, Ecke Ramlerstraße heute. Im Hintergrund ist die Swinemünder Brücke zu sehen.
Was fehlt
Ach, ich wollte mich so aufregen. Über einen früheren Arbeitgeber. Die Gründe sind gut genug, der Anlass aber nicht. Denn drauf gekommen bin ich, weil ich dreimal in ebenso vielen Wochen nah dran war (mehr als in den letzten drei Jahren zusammengenommen). Zwei Abschiedsfeiern dort, eine Reunion dazu.
Denn was soll das. Ich vermisse Menschen von da und habe mich gefreut, sie wiederzusehen. Was kümmert es mich also Jahre nach meinem Weggang, dass der Laden so ein Scheiß ist? Tja, eben.
***
Der verdiente Zitatgeber des Volkes, Frédéric Valin, schrieb mal irgendwo, dass es ihm gut tue, die Publikationen für die er schreibe nicht mehr zu lesen.
Viel besser lässt sich die Irrelevanz diverser linker oder pseudolinker Organe nicht zusammenfassen. So eine Art professional Facebook: Man schreibt was rein, bekommt immerhin 12,50 Euro dafür, liest den andern Kram aber besser nicht, sind eh alles Idioten.
Warum also überhaupt noch publizieren? Die Faschisten werden nicht mit der spitzen Feder aufgehalten. Außerdem ist die Zeit zu kurz, mit den andern 12,50-Nichtsnutzen darüber zu diskutieren, ab wie viel Punkten auf der Adolfskala man sich auch handgreiflich wehren darf. Aber irgendjemand muss natürlich die „Art und Weise“ anprangern, in der Widerständigkeit sich findet. Lina soll also Nazis weh getan haben. Hmm, ich bin sehr entschieden gegen Gewalt und genau deshalb hat diese mir ansonsten gänzlich unbekannte junge Frau meine Solidarität.
[jetzt bloß nicht schwach werden, keinen Unsinn verlinken]
***
Das ist das Internet, das angeblich nichts vergisst. Ich finde die besten Texte nicht mehr. Nicht von Freund*innen, nicht von Bekannten, nicht von verschämt Verehrten. Nicht den über die Emos von M. (der sich verpisst hat), nicht das Stück übers sich selber Wegschreiben von B. (den ich fragen kann, ob ers noch irgendwo hat).
Ich hatte keine so rechte Vorstellung, was das alles soll mit diesem Netz, aber ich mochte das, wollte Teil davon sein. Das war anstrengend.
Es geht mir viel besser heute, weil ich weiß was fehlt. Die Suche wird deshalb nicht leichter.
Notiert, vor Langeweile bebend
Schreib, Junge, schreib. Messehallen voller Bücher, geschrieben von deinesgleichen. Alle erklären deine Herkunft, deine Zeit, deine Welt.

Die statistische Lebensmitte überschritten hast du schon ein Weilchen. Deine Generation ist am Drücker. Deine Generation ist wichtig. Vorbei die zwanzig ungehörten Jahre, in denen nur eine Handvoll Wunderkinder früh herausragten. Zwanzig Jahre, in denen die Alten, denen die Welt unterm Arsch weggerutscht war, sich noch fragend umsahen und dabei nichts mehr verstanden. Am wenigsten sich selber. Und uns überhaupt nicht.
Jetzt aber drücken wir alle andren weg. Die Eltern können sich kaum noch wehren. Mit letzter Tinte notieren sie den letzten Blödsinn. Wir lachen drüber, in verschworener Einigkeit mit den Jüngeren, die schon begierig auf das arrivierte Prekariat schauen. Auf uns. Na, Momentchen mal. WIR wischen jetzt mit Pizzabrot die uns hinterlassenen Töpfe aus. Später seid ihr dran. Geduld ist eine Tugend.
Schreib, Junge, schreib. Sonst fährt der Diskurszug ohne dich nach Shangrila.
lies Jerofejew nicht! vorm einschlafen
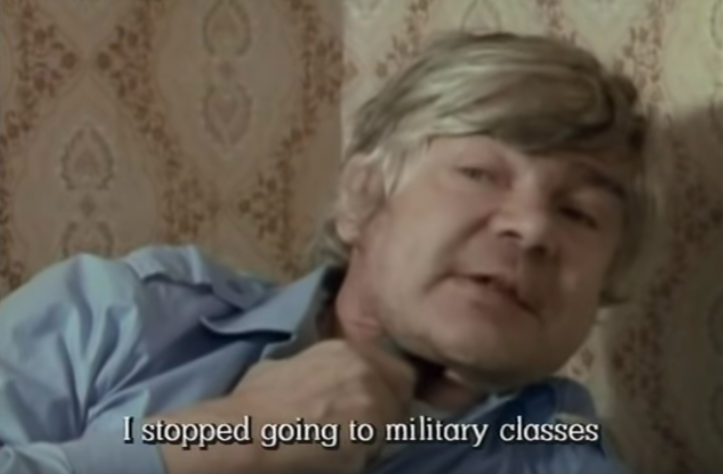
Bisschen schlecht durch die Nacht gekommen letztens, wegen eines Buchs, das mich emotional ganz schön angegangen ist. Schwierige Sache sowas, Sensibilität ist schließlich wieder out, irgendwelche langhaarigen TV-Filosofn wollen Bockbier und Männlichkeit retten, aber mich berühren Kunstwerke einfach zu leicht. Anlässlich des Todes von Sondheim verschiedene Versionen von „Send in the clowns“ gehört – Trä-nen-schlei-er (außer bei Sinatra natürlich).
Und gerade eben also Wenedikt Jerofejews „Die Reise nach Petuschki“ (Übersetzung von Natascha Spitz) gelesen. Diese apokalyptische Vision, die da doch etwas unvermittelt im letzten Viertel einsetzt, ist keine ideale Einschlaflektüre. Jaja, sooo unvermittelt kommt das selbstverständlich wiederum nicht; wenn man ein bisschen aufpasst, ist auch der ganze lockere Witz davor schon latent bedrohlich. Aus allen Poren schwitzt da die tiefe Religiosität, (enttäuschte) Heilserwartung fließt mit jedem Gramm Wodka, am Ende kommen zwangsläufig die vier Reiter, so steht‘s halt schon immer geschrieben.
Das Bild ist ein Screenshot von Youtube, wo es einen BBC-Film gibt, relativ kurz vorm Tod des Autors entstanden, über Leben und Werk, also vor allem Petuschki.

